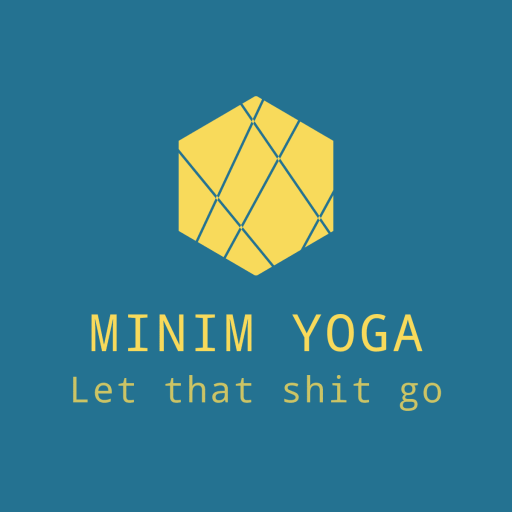Wenn ich an Freiheit denke, kommt mir das Gefühl von physischer Freiheit, von Möglichkeit, Leichtigkeit und Unbeschwertheit in den Kopf.

In diesem Sinne ergibt sich durch das Anhäufen von Dingen, aber auch von Ideologien und Geschichten, an denen wir festhalten und mit denen wir uns selbst beschränken, zwangsläufig das Gefühl von Unfreiheit.
Wir kennen das schon aus dem Urlaub: wie einfach war das Verreisen als junger Mensch? Ein Rucksack prall gefüllt mit dem Nötigsten und los ging es. Hat man hingegen Kinder gilt es vorausschauender zu packen. Gegebenenfalls angepasst an unterschiedliche denkbare Wetterlagen, vorsorglich für etwaige Unfälle und Krankheiten und an die jeweiligen Bedürfnisse der kleinen Familienmitglieder kommt da so einiges zusammen. Und zudem sammeln sich Souvenirs wie Steine, Muscheln, Mitbringsel an, die unbedingt auf der Rückfahrt mit zurückgebracht werden müssen. Da ist das Packen für die Rückfahrt alles andere als unbeschwert und leicht.
Ob im Alltagsleben, im politischen Sinne, unter dem Gesichtspunkt Simple Life oder in der Yoga-Philosophie – Freiheit ist Motivation, Ziel, Wunsch. Vielleicht basiert unser heutiges Verständnis von Freiheit aber auch einfach auf einem Missverständnis.

Was ist Freiheit
Bereits die Auseinandersetzung mit dem Begriff zeigt, dass unterschiedliche Kontexte und unterschiedliche Kulturen ein völlig anderes Verständnis von Freiheit haben können.
Die politische Freiheit, wie sie in vielen Verfassungen, wie unserem Grundgesetz, Niederschlag gefunden hat, sichert in Form von Freiheitsrechten die grundlegenden Rechte jedes Menschen. Diese Art der Freiheit ist nicht absolut. Sie kann durch weitere Gesetze eingeschränkt werden, wenn dies zum Schutz anderer Rechtsgüter oder zur Wahrung der öffentlichen Sicherheit erforderlich ist. Wir konnten das zuletzt in Zusammenhang mit der Corona-Pandemie in den Jahren 2020 bis 2022 erfahren. Aber die politische Freiheit schenkt uns eine Basis für Stabilität und Sicherheit.
Neben der politischen Freiheit, denken wir im Westen bei Freiheit oft an Entscheidungsfreiheit, die Freiheit etwas zu tun oder zu lassen (positive Freiheit) oder die Freiheit von beispielsweise Krankheiten oder Einschränkungen (negative Freiheit). Dabei zeigt sich, dass wir, die wir im politischen Sinne ein freies Leben führen dürfen, oft weniger an eine kollektive Freiheit als vielmehr an unsere individuelle Freiheit denken.
Das Wissenschaftsjahr 2024 hat sich dem Thema „Freiheit“ gewidmet. Insbesondere das „Freiheitsarchiv“ dokumentiert den heutigen Freiheitsbegriff in unserer Gesellschaft.

Betrachtet man die indogermanische Herkunft des Wortes „Freiheit“ hat der Begriff seine heutige Bedeutung über das germanische
*frī-halsa = „jemand, dem sein Hals selbst gehört“,
der also über seine Person selbst verfügen kann, erhalten. Ebenfalls aus der indogermanischen Wurzel lässt sich etymologisch herleiten, dass jemand, der frei ist, zu einer Gemeinschaft von einander Nahestehenden und Gleichberechtigten gehört. Innerhalb dieser Gemeinschaft herrscht ein friedlicher Zustand. Die Gemeinschaft ist bereit, diesen inneren Frieden gemeinsam gegen Übergriffe von Dritten verteidigen. Somit war „Freiheit“ im Sinne einer individuellen Freiheit als Rechtsstatus relativ zu einer Gemeinschaft und im Sinne einer kollektiven Freiheit an die Bereiche gebunden, in denen die Gemeinschaft normative Herrschaft ausübt.
In der philosophischen Betrachtung westlicher Philosophien stellt sich vor allem die Frage, wie weit Freiheit gehen darf und wodurch sie aus sich selbst heraus beschränkt ist. So wurde beispielsweise durch den kategorischen Imperativ nach Kant definiert, dass der Mensch nur frei handelt, wenn er pflichtgemäß (nach seiner vernunftbasierten Beurteilung) handelt.
Freiheit in der Alltagswahrnehmung
Im Erwachsenendasein finden wir uns oft mit Beruf und Familie in einem Gestrick von Verantwortungen und Verpflichtungen, was uns das Gefühl von „Un-Freiheit“ vermittelt. Die meisten von uns denken daher bei „Freiheit“ vor allem an Selbstbestimmung, aber auch Abenteuer und Loslassen. Oft sind diese Gedanken mit einer Sehnsucht verbunden. Zugleich sind Beruf und Familie doch gerade die Dinge, von denen wir vielleicht in jungen Jahren geträumt haben. Die wir angestrebt haben.
Woher kommt es also, dass sogar diejenigen von uns, die ein Leben führen dürfen, dass den vormaligen Träumen gerecht wird, manchmal ein Gefühl der Sehnsucht nach „Freiheit“ haben?
Alles ein großes Missverständnis?
Wenn wir bei dem Verständnis von Freiheit als Entscheidungsfreiheit für und gegen etwas bleiben, dann setzt dieses Verständnis voraus, dass jeder von uns ein „Träger“ der Eigenschaft des „Freiseins“ sein kann. Diese Idee setzt also voraus, dass es ein Selbst gibt, das frei sein soll oder darf. Im Yoga wird ein solches Selbst als „Atman“ bezeichnet.
Im Zen-Buddhismus indes wird ein solches Selbst als solches negiert. Der Buddha soll zu der Erkenntnis gekommen sein, dass es kein Atman gibt („An-Atman“) und somit auch keine eigenständige Substanz wie das Ich, die frei sein kann oder nicht.
Der Freie Wille
Wenn man diesen Gedanken weiterspinnt, folgt daraus, dass auch der Freie Wille nicht existiert. Echte Selbstbestimmung setzt jedoch einen freien Willen voraus.
Aus vielen Wissenschafts-Bereichen, wie beispielsweise der Neurowissenschaft und Humanbiologie, bringen jüngere Beobachtungen und Forschungsergebnisse das Konzept des freien Willens ins Wanken. Das, was wir als Ich wahrnehmen, zeigt sich als unglaublich leicht beeinflussbar und impulsiv, wobei die Einflüsse nicht nur von außen, sondern auch aus unserem Inneren erfolgen können (Stichwort Mikrobiom).
Insofern erscheint das Konzept des Zen-Buddhismus, wonach nichts aus sich heraus unabhängig, substantiell oder von Dauer ist, sondern alles als Wechselbeziehung erscheint, stimmig.
Wenn wir Entscheidungen treffen, stehen sich oft in Wechselbeziehung zwei oder mehr Impulse gegenüber, beispielsweise bei der Frage: „Soll ich heute Yoga praktizieren oder lieber auf der Couch entspannen“. Diese Impulse sind jedoch nicht frei gewählt, sondern präsentieren sich von außen und/oder innen und eine vermeintlich durch den freien Willen getroffene Entscheidung ist eher eine Kontrolle der auf einen einstürmenden Impulse.

Was wir für unseren Alltag als Freiheit gewinnen können
Wenn wir uns „un-frei“ in unserem Alltag fühlen, kann man dies auf eine Vielzahl möglicherweise auch stärkerer Impulse zurückführen, die von außen (und gegebenenfalls auch von innen) auf uns einwirken. Daher fühlen wir uns auch manchmal so „getrieben“.
Im Kontext des Zen-Buddhismus ist jeder von uns nicht ein (isoliertes) Selbst, sondern Teil eines Ganzen und folglich ist alles, was in jedem Moment ist – uns eingeschlossen – ein Ergebnis von Wechselbeziehungen und genauso so wie es sein soll. Daraus resultiert die Freiheit von dem Wunsch, dass es doch anders sein sollte, und die Akzeptanz dessen, was ist, kann leichter fallen.
Nichtsdestotrotz ist es aus meiner Sicht wichtig, Missstände im eigenen Leben als solche zu identifizieren und diese im Rahmen des Möglichen zu ändern. Hierzu ist es notwendig, sich mit sich Selbst (nicht nur als individuelles Ich, sondern auch zur Beurteilung innerer Impulse) zu beschäftigen.
In der Yoga-Philospohie wurde Freiheit oftmals als Befreiung von etwas gesehen. Moksha, die Befreiung aus dem Lebenskreislauf Samsara, und die Erkenntnis des wahren Selbst (Atman) durch Abstreifen des Schleiers des Vergessens. Oder als das Erinnern daran, dass wir alle eins sind mit dem EINEN Bewusstsein. Die Yogapraxis, sowohl in einer körperlichen Praxis als auch in Beschäftigung mit philosophischen Fragen und in Meditation sollte dabei helfen, Zugang zu seinem Innersten zu finden.
Yoga und Bewusstheit
Im alltäglichen Leben kann uns Yoga unterstützen, zu erfahren, wer wir wirklich sind. Nicht zur Selbstoptimierung, sondern für Selbsterkenntnis. In gleicher Weise helfen auch einfache kleine Momente des Innehaltens und ein achtsamer Umgang mit unseren eigenen Ressourcen (Zeit, Energie, Geld).

So kann es hilfreich sein, sich darauf besinnen, in wie weit die Verantwortungen und Einschränkungen, die ich als negativ erlebe, mit meinen Entscheidungen für etwas zusammenhängen. Auf diese Weise ist es möglich, bei zukünftigen Entscheidungen diese Erfahrung als weiteren Impuls mit einfließen lassen. Mein „JA“ zu einer Sache ist ursächlich für spätere Einschränkungen, mit denen ich rechnen musste.
Auch umfassen unsere Entscheidungen oft ein Anhäufen von materiellen Dingen in unserem Leben, die uns zusätzlich das Gefühl von Un-Freiheit vermittelt. Besitz belastet. Daher kann das Loslassen von materiellen Besitztümern und den damit verbundenen Verantwortungen auch als sehr befreiend erlebt werden.
Schmerz ist unvermeidlich, Leiden ist eine Option – was uns widerfährt, Positives wie Negatives, können wir nur sehr beschränkt beeinflussen. Wie wir darauf reagieren indes schon. Darin wurzelt nach den Lehren des Buddha die wahre Freiheit des Menschen. Indem wir nicht ungefiltert und unmittelbar reagieren, sondern Raum lassen, unsere Reaktion und Emotion auf negative Erlebnisse zu beobachten, können wir aus typischen Mustern ausbrechen und darin eine neue ungeahnte Freiheit entdecken.
Es mag dahinstehen, ob wir über einen freien Willen verfügen oder nicht. Entscheidend ist, ob wir uns frei fühlen. Und für dieses Gefühl können wir einiges tun. Indem wir unsere Wahrnehmung des alltäglichen Lebens verändern und unsere Sichtweise darauf. Und indem wir selbsterschaffene Fesseln als solche erkennen und abstreifen.