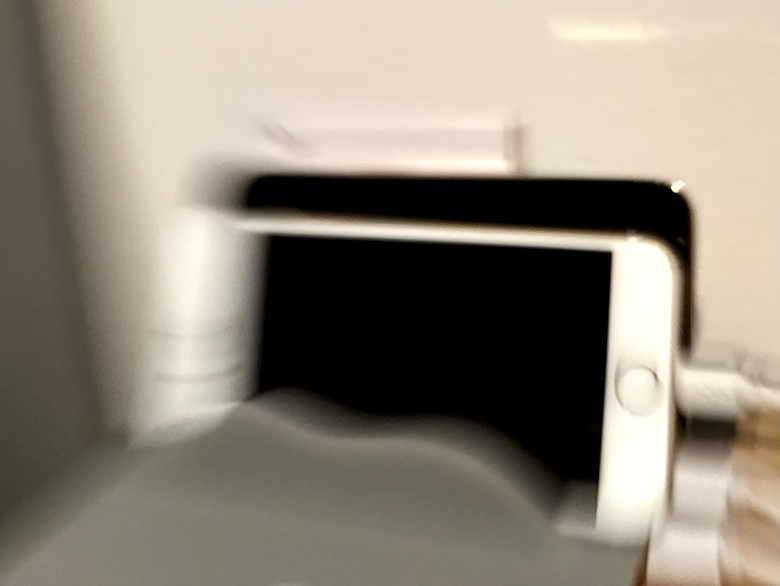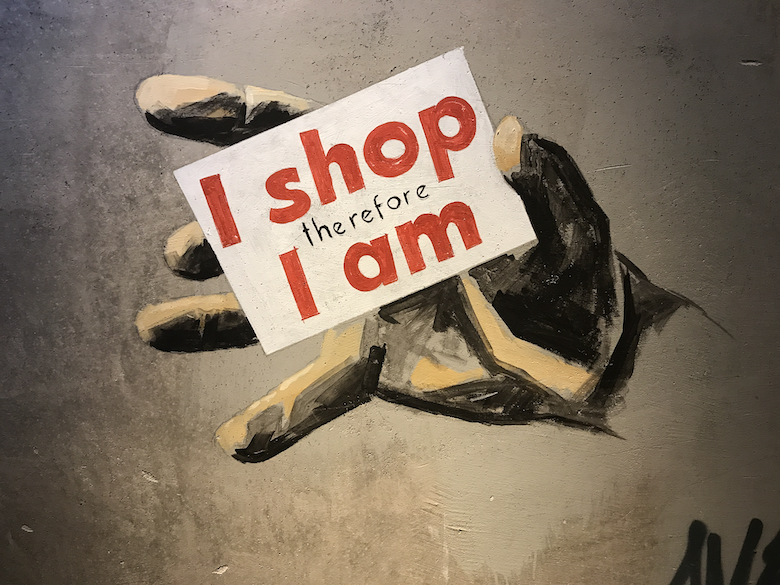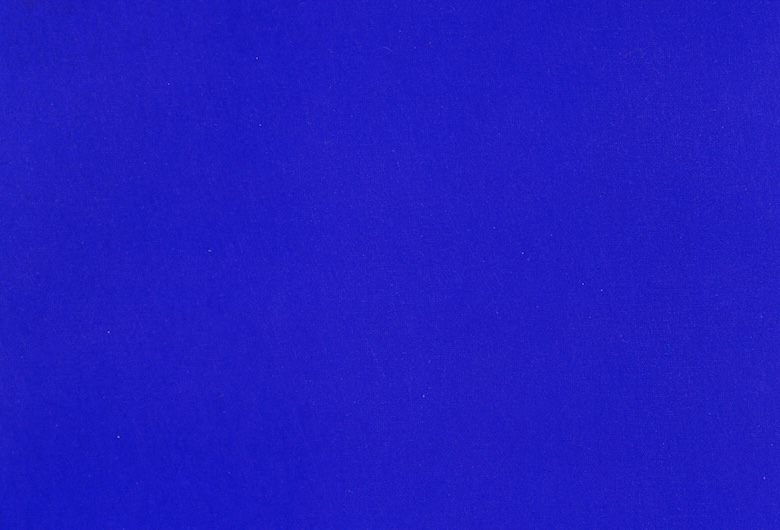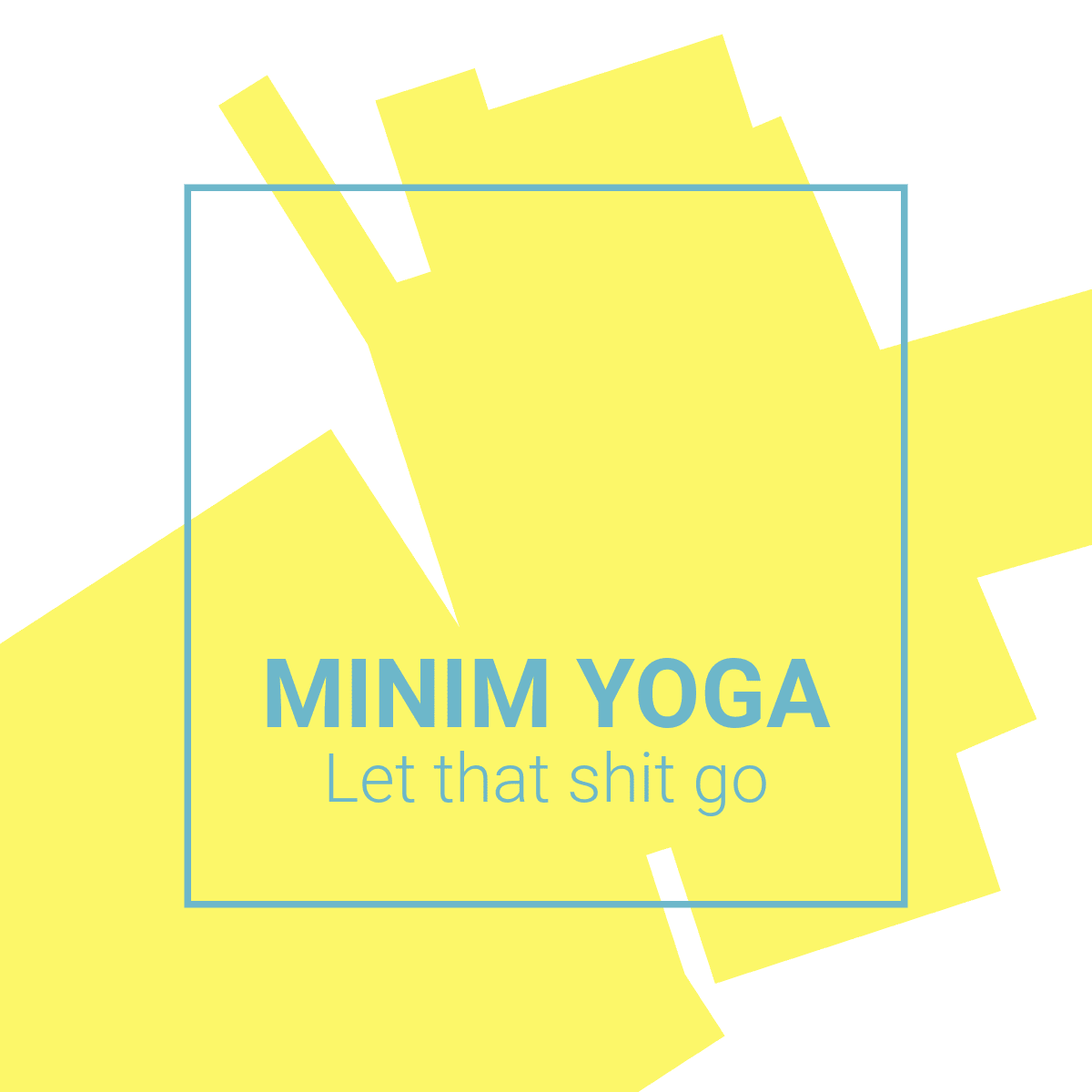Hatha Yoga • Ashtanga Yoga • Vinyasa Yoga • Iyengar Yoga • Yin Yoga • Yin Yang Yoga • Kundalini Yoga • Anusara Yoga • Bikram Yoga • Power Yoga • Vini Yoga • Air Yoga • Faszien Yoga
Welches Yoga machst Du?
Als mir in der Vergangenheit diese Frage gestellt wurde, konnte ich gar nicht antworten. Meine Yogaklasse hatte keinen offiziellen Namen und der Stil war eher ein Mix aus vielen Elementen.
Selbst nach einem tieferen Einblick in die unterschiedlichen Yogasysteme und viele unterschiedliche Yogaklassen später, kann ich noch immer keine eindeutige Antwort geben. Wenn ich alleine praktiziere, mache ich „mein Yoga“. Dieses ist an meine Tagesform und meine aktuellen Bedürfnisse angepasst. Es finden sich Elemente von Meditation, Vinyasa Yoga, Hatha Yoga und Pranayama in unterschiedlicher Gewichtung in meiner persönlichen Praxis. Manchmal bleibe ich unerwartet in meinem Sitz, weil die Meditation sich so gut anfühlt. Ein anderes Mal ist es ein dynamischer Flow, der mir gut tut. Und zuweilen genieße ich eine Praxis mit Harmonium und Gesang.

Yogakommerzialisierung
Heute kennt so gut wie jeder den Begriff „Yoga“ und verbindet damit Entspannung, Sport, Gymnastik. Aber die Vielzahl an Yogaarten, die sich inzwischen entwickelt haben, lassen sich kaum mehr überblicken. Und die vorstehende Aufzählung ist bei weitem nicht abschließend.
Seit den 90er Jahren steht Yoga für ein Milliardengeschäft. Der wirtschaftliche Yogaumsatz wurde bereits im Jahr 2017 auf 65 Milliarden Euro geschätzt, Tendenz steigend. Für das Jahr 2025 wird weltweit ein Volumen von etwa 200 Milliarden Euro erwartet (Quelle: ScottMax).
Für die inzwischen geschätzt 300 Milliarden Yogis weltweit ist Yoga auch ein Lifestyle, der für Gesundheit und Selbstfürsorge steht. Die sogenannten Yogapants sind in einigen Teilen der Welt mehr Statement („ich bin hip und fit“) als Kleidungsstück. Und schicke Yogastudios sind aus großen Städten im Westen nicht mehr wegzudenken.
Wenig verwunderlich ist daher, dass viele Yogastile heute ebenfalls Markencharakter haben. Und Studios, die wie Franchise-Unternehmen funktionieren, sind keine Besonderheit mehr, wie beispielsweise Bikram-Yoga-Studios oder Jivamukti-Yoga-Studios überall in der Welt.
Aber ist diese Vielfalt wirklich ein neues Phänomen, das mit dem weltweiten Erfolg von Yoga zu tun hat?
Der Einfluss der Lehrer
Der moderne Yoga, wie wir ihn heute kennen, hat sich aus einem Austausch der indischen Kultur und der westlichen Kultur entwickelt. Dabei spielten die alten indischen Schriften zum Yoga und alten Yogatraditionen eine große Rolle. Aber es flossen auch Elementen der indischen Ringerkultur, sowie Einflüsse der westlichen Gymnastik- und Bodybuilderkultur hinein. Vor allem aber wurde der moderne Yoga von den Lehrern geprägt, die diesen in die Welt getragen haben.
Die Lehrer-Schüler-Beziehung
Schon lange vor dem, was wir als modernen Yoga kennen, war der Yoga in höchstem Maße durch den Lehrer bzw. Guru geprägt. Dieser lebte in mehrjähriger Schüler-Lehrer-Beziehung mit seinem Schüler, um diesem in mündlicher Überlieferung die Geheimlehre Yoga zu übertragen.
Und auch später, als die ersten indischen Lehrer im 19. Jahrhundert unterschiedliche Yogastile entwickelten, in den Westen brachten und dort unterrichteten, hat jeder von ihnen dem Yoga seinen eigenen Stempel aufgedrückt, sei es durch die Vermischung mit westlichen Einflüssen oder durch die Anpassung auf spezifischen Bedürfnisse ihrer Schüler.
Unverändert entwickeln sich seither immer wieder neue Yogastile, die mit unterschiedlichem Fokus die drei Haupt-entwicklungsstränge des Yoga, nämlich Yoga als Philosophie, Yoga als Therapie und Yoga als Sport, miteinander verweben. Im Ergebnis führt das zu einem immer größer werdenden Pool an Auswahlmöglichkeiten. Gerade als Anfänger kann das verwirrend sein, wenn man sich seinen für sich passenden Yogastil sucht.
Da aber auch innerhalb eines Yogasystems oder -stils der einzelne Lehrende (mit seinen Erfahrungen und seinem Unterrichtsstil) und seine Schüler eine Yogaklasse maßgeblich beeinflussen, empfehle ich sich bei der Auswahl des für einen passenden Yogas vor allem unterschiedliche Lehrer (ruhig auch mit unterschiedlichen Stilen) auszuprobieren.
Denn Yoga ist und bleibt ein Werkzeug, das von jedem Menschen anders eingesetzt werden kann, unabhängig davon wie ich das spezifische Werkzeug nenne.
Yoga in Indien heute – Fokus auf Yogatherapie
Bis heute unterscheidet sich die Yogakultur in Indien deutlich von dem, wie wir im Westen Yoga praktizieren.
So wird in Indien in der Regel kein Gruppen- oder Klassenunterricht angeboten. Das liegt daran, dass Yoga als Therapie die meistverbreitete Form von Yoga in Indien darstellt. Hier wird in klinikartigen Yogainstituten ein auf den jeweiligen Schüler/Patienten eine maßgeschneiderte Praxis zusammengestellt, die dieser zunächst unter Anleitung und später oder parallel zuhause anwenden soll.
Der Gruppenunterricht – ein Yoga für alle – ist indes die Ausnahme und richtet sich in der Regel an die Ausbildung von Yogalehrenden oder an Ausländer.
MINIM YOGA als Mix
Ich selbst genieße die Energie, die sich daraus ergibt, mit einer Gruppe von mehreren Schülern Yoga zu praktizieren, unabhängig davon, ob ich selbst einer davon bin oder unterrichte.
Zugleich habe ich durch das Unterrichten erkennen müssen, wie unterschiedlich wir Menschen doch voneinander sind. Nicht nur, weil in einer offenen Studioklasse unterschiedliche Level, Alter, Geschlechter und Zielsetzungen zusammenkommen, sondern auch, weil selbst in einer vergleichsweise homogenen Klasse (beispielsweise in einem Teachertraining) jeder Körper anders ist.
Um dem besser gerecht zu werden und auf den einzelnen eingehen zu können, bevorzuge ich den Einzel- und Kleingruppenunterricht in privater Atmosphäre. Hier- in einem geschützten Raum – fällt es leichter sich als Praktizierender auf sich selbst zu konzentrieren und in die eigene Mitte zukommen. Um alles loslassen zu können.
Und als Begleiter kann ich meinen Unterricht besser auf die Bedürfnisse des Einzelnen und die körperlichen Besonderheiten ausrichten.

Viel Freude an Deinem Yoga – egal wie Deine Praxis heute für Dich aussehen mag.